Product · 20 min read
Was ist Unbewusst, Nicht-Bewusst und Unterbewusst?
Ein kurzer Überblick über die unbewussten, nicht-bewussten und vorbewussten Prozesse, die das menschliche Denken und Handeln beeinflussen.

Die Architektur des Bewusstseins: Unterscheidung zwischen unbewussten, nicht-bewussten und vorbewussten mentalen Prozessen
Zusammenfassung
Dieser Artikel bietet einen umfassenden Überblick über die Unterschiede zwischen unbewussten, nicht-bewussten und vorbewussten mentalen Prozessen – wichtige Konzepte in der Kognitionswissenschaft, Psychologie und Neurowissenschaft. Obwohl diese Begriffe in der öffentlichen Diskussion oft miteinander verwechselt werden, ist ein präzises wissenschaftliches Verständnis für die genaue theoretische Modellierung und empirische Untersuchung des menschlichen Geistes unerlässlich. Wir untersuchen den historischen Kontext mit Schwerpunkt auf dem psychoanalytischen Rahmenwerk Freuds und vergleichen ihn mit modernen neurowissenschaftlichen und kognitionspsychologischen Perspektiven. Wichtige Phänomene wie implizite Prozesse, unterschwellige Wahrnehmung, Blindsicht, prädiktive Kodierung und autonome Regulation werden als Manifestationen dieser unterschiedlichen Bewusstseinsebenen untersucht. Wir diskutieren methodische Ansätze, darunter Neuroimaging (EEG, ERP, fMRI) und Verhaltensparadigmen (maskierte Prime-Aufgaben und Reaktionszeit-Experimente), als Werkzeuge für ihre empirische Untersuchung. Der Artikel schließt mit einer Betonung der tiefgreifenden Auswirkungen dieser nicht-bewussten und unbewussten Prozesse auf die Emotionsregulation, die Entscheidungsfindung und das gesamte menschliche Verhalten.
1. Einleitung: Die Ebenen der mentalen Operationen
Die menschliche Wahrnehmung und das menschliche Verhalten sind das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels von Prozessen, die auf verschiedenen Bewusstseinsebenen ablaufen. Obwohl bewusste Erfahrungen unsere unmittelbare subjektive Realität darstellen, findet ein Großteil der mentalen Aktivitäten außerhalb des Bereichs der direkten Selbstbeobachtung statt. Die Begriffe „unbewusst“, „nicht bewusst“ und „unterbewusst“ werden häufig verwendet, um diese verborgenen mentalen Prozesse zu beschreiben, aber ihre genauen Definitionen und ihre wissenschaftliche Verwendbarkeit können sich stark von ihrer Verwendung im alltäglichen Sprachgebrauch unterscheiden.
Die Erforschung nicht-bewusster mentaler Zustände gewann historisch gesehen mit Sigmund Freuds psychoanalytischer Theorie an Bedeutung, die von einem aktiven Unbewussten ausgeht, das mit verdrängten Wünschen und Erinnerungen gefüllt ist. Die moderne Kognitionswissenschaft und Neurowissenschaft haben diese Konzepte jedoch erweitert und verfeinert und dabei verschiedene Kategorien nichtbewusster Prozesse identifiziert, die empirisch überprüft und mechanistisch erklärt werden können. Das Verständnis dieser Unterschiede ist entscheidend für die Weiterentwicklung der Forschung in der kognitiven Psychologie, der Verhaltensneurowissenschaft und der klinischen Praxis, da diese zugrunde liegenden Prozesse einen tiefgreifenden Einfluss auf Wahrnehmung, Emotionen, Entscheidungsfindung und Motorik haben.
In dieser Übersicht werden die Bereiche des Bewusstseins, des Unbewussten, des Nicht-Bewussten und des Vorbewussten systematisch definiert und voneinander abgegrenzt, wobei empirische Beispiele und relevante theoretische Modelle zur Veranschaulichung herangezogen werden. Wir werden auch die Problematik des Begriffs „Unterbewusstsein” im wissenschaftlichen Diskurs erörtern und die Methoden zur Untersuchung dieser schwer fassbaren mentalen Phänomene skizzieren.

2. Das Bewusstsein: Phänomenales Bewusstsein und exekutive Kontrolle
Bewusstsein wird oft als der Zustand definiert, sich seiner inneren und äußeren Existenz bewusst zu sein. Es stellt den Höhepunkt subjektiver Erfahrung und kognitiver Kontrolle dar. Es umfasst das phänomenale Bewusstsein von Sinneseindrücken, Gedanken, Emotionen und Erinnerungen sowie die Fähigkeit zu bewusster Selbstbeobachtung und willkürlichem Handeln. Das Bewusstsein zeichnet sich durch seine begrenzte Kapazität und sequenzielle Verarbeitung sowie seine Rolle bei der Lösung neuer Probleme, der Planung und dem flexiblen Verhalten aus (Baars, 1988).
Zu den wichtigsten Merkmalen der bewussten Verarbeitung gehören:
- Subjektive Erfahrung (Qualia): Die einzigartige, subjektive qualitative Natur von Empfindungen, Wahrnehmungen und Emotionen.
- Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis: Die Fähigkeit, sich selektiv auf relevante Informationen zu konzentrieren und diese in einem aktiven, leicht zugänglichen Zustand für die Verarbeitung zu halten.
- Willkürliche Kontrolle: Die Fähigkeit, Handlungen, die von Zielen und Plänen geleitet sind, absichtlich zu initiieren oder zu hemmen.
- Metakognition: Das Bewusstsein und die Regulierung der eigenen kognitiven Prozesse, einschließlich der Überwachung und Bewertung der eigenen Gedanken und des eigenen Lernens.
Obwohl die genauen neuronalen Korrelate des Bewusstseins noch erforscht werden, ist allgemein anerkannt, dass sie eine weitreichende, integrierte Aktivität in verschiedenen Hirnregionen umfassen, insbesondere im präfrontalen und parietalen Kortex sowie im Thalamus (Dehaene & Changeux, 2011). Das Bewusstsein fungiert als eine Art globales Übertragungssystem, das Informationen für viele spezialisierte kognitive Module verfügbar macht und komplexe Entscheidungsprozesse sowie adaptive Reaktionen auf Umweltanforderungen ermöglicht (Baars, 2002).
3. Das Unbewusste: Dynamische Einflüsse jenseits des direkten Zugriffs
Das Konzept des Unbewussten hat sich seit seiner ursprünglichen Formulierung erheblich weiterentwickelt. In der zeitgenössischen wissenschaftlichen Psychologie bezieht sich das Unbewusste auf mentale Prozesse und Inhalte, die derzeit nicht für das Bewusstsein zugänglich sind, aber dennoch Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen beeinflussen können. Dies unterscheidet sich vom Freudschen psychoanalytischen Konzept des Unbewussten, das den Schwerpunkt auf verdrängtes Material legt, das oft traumatischer Natur ist und durch psychologische Abwehrmechanismen aktiv aus dem Bewusstsein ferngehalten wird (Freud, 1915).

3.1. Das Unbewusste nach Freud
Sigmund Freud stellte die These auf, dass das Unbewusste der primäre Determinant der Persönlichkeit und Psychopathologie sei. Dieses dynamische Unbewusste wurde als Speicherort für inakzeptable Gedanken, Erinnerungen und Wünsche verstanden, insbesondere solche, die mit Erfahrungen aus der frühen Kindheit zusammenhängen und verdrängt wurden, weil sie als bedrohlich empfunden wurden. Laut Freud manifestieren sich diese unbewussten Konflikte indirekt durch Träume (latenter Inhalt), neurotische Symptome und Parapraxen (z. B. Freudsche Fehlleistungen). Psychoanalytische Techniken wie freie Assoziation und Traumdeutung wurden entwickelt, um diese verborgenen Inhalte aufzudecken und die zugrunde liegenden psychischen Belastungen zu lösen (Freud, 1915). Obwohl es für viele Freudsche Konstrukte nur begrenzte empirische Belege gibt, legte seine Betonung der außerhalb des Bewusstseins ablaufenden mentalen Prozesse den Grundstein für nachfolgende Forschungen.
3.2. Das moderne kognitive Unbewusste
Die moderne kognitive Psychologie und Neurowissenschaft begreifen das Unbewusste als eine Sammlung verschiedener Prozesse, die oft adaptiv sind und automatisch und effizient ablaufen, ohne dass eine bewusste Kontrolle erforderlich ist. Diese Prozesse werden nicht unbedingt verdrängt, sondern liegen einfach außerhalb des aktuellen Fokus der Aufmerksamkeit. Zu den wichtigsten Erscheinungsformen gehören:
- Implizite Prozesse: Diese beziehen sich auf kognitive Vorgänge, die ohne bewusste Absicht oder Wahrnehmung ablaufen, aber dennoch das Verhalten beeinflussen. Beispiele hierfür sind:
- Implizites Gedächtnis: Wissen, das ohne bewusste Erinnerung erworben und ausgedrückt wird, wie z. B. prozedurale Fähigkeiten (z. B. Fahrradfahren oder Tippen) oder die Auswirkungen vergangener Erfahrungen auf die aktuelle Leistung (z. B. Priming) (Schacter, 1987).
- Implizites Lernen: Der Erwerb komplexer Informationen, ohne sich bewusst zu sein, was gelernt wurde oder wie das Lernen stattgefunden hat (Reber, 1989).
- Subliminale Reize und Wahrnehmung: Reize, die unterhalb der Schwelle der bewussten Wahrnehmung präsentiert werden (z. B. sehr kurze visuelle Darstellungen oder schwache akustische Signale), können dennoch vom Gehirn verarbeitet werden und nachfolgende Urteile, Einstellungen oder Verhaltensweisen beeinflussen (Kouider & Dehaene, 2007). Neuroimaging-Studien haben gezeigt, dass unterschwellige Reize relevante Gehirnregionen auch ohne bewusste Wahrnehmung aktivieren können (Whalen et al., 1998).
- Priming: Ein Phänomen, bei dem die Exposition gegenüber einem Reiz (dem Prime) die Verarbeitung eines nachfolgenden Reizes (dem Target) beeinflusst, oft ohne dass sich die Person des Prime bewusst ist. Priming-Effekte können semantischer, wahrnehmungsbezogener oder konzeptueller Natur sein und zeigen die Vernetzung mentaler Repräsentationen und die automatische Aktivierung assoziierter Informationen (Bargh & Chartrand, 1999).
Diese Perspektiven betonen den funktionalen und adaptiven Charakter unbewusster Prozesse und zeigen, wie diese die alltägliche Wahrnehmung, das Gedächtnis, die Entscheidungsfindung und das Sozialverhalten beeinflussen.
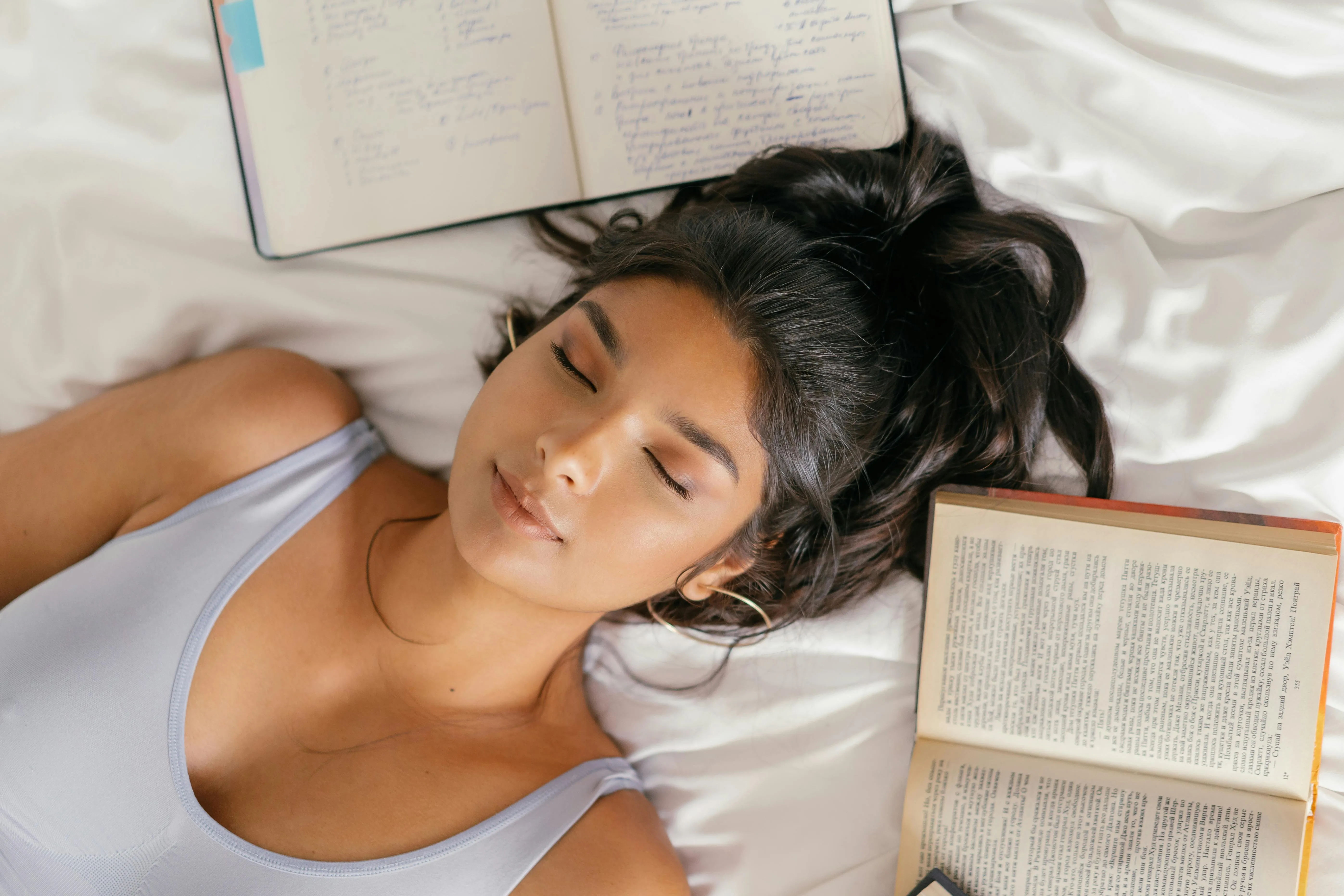
4. Das Unbewusste: Unzugängliche physiologische und kognitive Vorgänge
Der Begriff „nicht-bewusst“ bezieht sich auf mentale und physiologische Prozesse, die vollständig außerhalb des Bereichs des bewussten Wahrnehmens ablaufen und von Natur aus für die Selbstbeobachtung unzugänglich sind. Im Gegensatz zum Unbewussten, das Inhalte enthalten kann, die grundsätzlich ins Bewusstsein gebracht werden könnten (z. B. durch Therapie oder erhöhte Aufmerksamkeit), sind nicht-bewusste Prozesse grundlegende, automatische Vorgänge, die nicht für den bewussten Zugriff bestimmt sind. Diese Prozesse sind für die Aufrechterhaltung der körperlichen Homöostase, die Ausführung von Routinehandlungen und die schnelle Interaktion mit der Umgebung unerlässlich.
Beispiele für nicht-bewusste Prozesse sind:
- Autonome Regulation: Die unwillkürliche Steuerung lebenswichtiger Körperfunktionen wie Herzfrequenz, Atmung, Verdauung und Thermoregulation durch das autonome Nervensystem (ANS). Diese Prozesse laufen kontinuierlich und automatisch ab, um das physiologische Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, ohne dass eine bewusste Intervention erforderlich ist (Harrison et al., 2013).
- Motorische Vorbereitung und Ausführung: Die komplexen neuronalen Berechnungen, die bei der Planung, Einleitung und Ausführung von Bewegungen eine Rolle spielen, finden oft außerhalb des Bewusstseins statt. Obwohl die Absicht, sich zu bewegen, bewusst sein mag, sind die komplizierten Abläufe der Muskelaktivierung und sensorischen Rückkopplungsschleifen weitgehend unbewusst. Studien unter Verwendung elektrophysiologischer Methoden (z.B. Bereitschaftspotenziale) zeigen, dass der bewussten Wahrnehmung einer bevorstehenden Bewegung eine vorbereitende Gehirnaktivität vorausgeht (Libet et al., 1983).
- Blindsehen: Hierbei handelt es sich um einen bemerkenswerten neurologischen Zustand, der durch eine Schädigung des primären visuellen Kortex (V1) verursacht wird. Patienten mit dieser Erkrankung berichten, dass sie in einem bestimmten Teil ihres Gesichtsfeldes keine bewusste visuelle Wahrnehmung haben, dennoch können sie auf visuelle Reize, die in diesem „blinden” Feld präsentiert werden, genau reagieren. Sie können beispielsweise die Ausrichtung einer Linie oder die Bewegungsrichtung richtig angeben, was zeigt, dass visuelle Informationen unbewusst über alternative subkortikale Bahnen verarbeitet werden (Weiskrantz, 1986). Blindsehen liefert überzeugende Beweise für eine Trennung zwischen visueller Verarbeitung und bewusster Wahrnehmung.
- Visuelle Vernachlässigung (hemispatial neglect): Eine neuropsychologische Störung, die typischerweise durch eine Schädigung einer Gehirnhälfte verursacht wird und bei der Patienten trotz intakter sensorischer und motorischer Fähigkeiten nicht in der Lage sind, auf Reize auf der gegenüberliegenden Seite des Raums zu reagieren. Entscheidend ist, dass sich die Patienten ihrer Vernachlässigung oft nicht bewusst sind, was die unbewusste Natur des Aufmerksamkeitsdefizits unterstreicht (Vallar & Perani, 1986). Dieser Zustand verdeutlicht, wie grundlegende Aspekte des räumlichen Bewusstseins außerhalb der bewussten Erfahrung funktionieren können.
Diese unbewussten Prozesse sind für ein effizientes und anpassungsfähiges Funktionieren unerlässlich. Sie entlasten das Bewusstsein von Routineaufgaben und lebenswichtigen Vorgängen, dessen Kapazität begrenzt ist. Dadurch kann sich das Bewusstsein auf neue oder komplexe Herausforderungen konzentrieren.
5. Das Vorbewusste: Informationen an der Schwelle des Bewusstseins
Das Vorbewusstsein ist eine eigenständige Ebene der mentalen Funktionen, die durch Informationen gekennzeichnet ist, die derzeit nicht im Bewusstsein vorhanden sind, aber leicht zugänglich sind und mit minimalem Aufwand abgerufen werden können. Es fungiert als mentaler Puffer oder temporärer Speicherbereich für Informationen, die derzeit nicht verwendet werden, aber sofort abgerufen werden können. Ursprünglich von Freud als „mentaler Warteraum” beschrieben, in dem Gedanken verbleiben, bevor sie ins Bewusstsein gelangen (Freud, 1915), ist das Vorbewusstsein eine eigenständige Ebene der mentalen Funktionsweise.
Beispiele für vorbewusste Inhalte sind:
-
Zugängliche Erinnerungen: Persönliche Fakten (z. B. die eigene Adresse oder Telefonnummer), Allgemeinwissen (z. B. die Hauptstadt Frankreichs) und aktuelle Ereignisse (z. B. was man zum Frühstück gegessen hat) werden in der Regel im Unterbewusstsein gespeichert. Diese Erinnerungen nehmen keinen ständigen Platz im Bewusstsein ein, können aber bei Bedarf leicht abgerufen werden.
-
Fähigkeiten und Gewohnheiten (wenn sie nicht aktiv genutzt werden): Während die Ausführung von gut eingeübten Fähigkeiten unbewusst erfolgen kann (z. B. Gehen), befindet sich das Wissen darüber, wie man sie ausführt, im Unterbewusstsein, wenn sie nicht aktiv genutzt werden, und kann bei Bedarf ins Bewusstsein gerufen werden (z. B. um zu erklären, wie man einen Schnürsenkel bindet).
Das Vorbewusstsein fungiert als entscheidender Vermittler, der den Informationsfluss zwischen dem riesigen und unzugänglichen Unterbewusstsein und dem begrenzten aktiven Bewusstsein erleichtert. Es ermöglicht eine effiziente kognitive Funktion, indem es relevante Informationen bereitstellt, ohne die bewusste Verarbeitung zu überfordern.
6. Das Unterbewusstsein: Ein Begriff ohne wissenschaftliche Präzision
Der Begriff „Unterbewusstsein“ wird in der Populärpsychologie, in Selbsthilfeliteratur und im Alltagssprachgebrauch häufig verwendet und oft synonym mit „Unbewusstes“ oder „Vorbewusstes“ verwendet. In der akademischen Psychologie und Neurowissenschaft wird er jedoch aufgrund seiner Mehrdeutigkeit und fehlenden präzisen wissenschaftlichen Definition weitgehend vermieden. Sigmund Freud verwendete ursprünglich den Begriff „Unterbewusstsein“, gab ihn jedoch später zugunsten des präziser definierten Begriffs „Unbewusstes“ auf, um die dynamischen, verdrängten Aspekte der Psyche zu bezeichnen (Freud, 1915).
Das Hauptproblem des Begriffs „Unterbewusstsein“ ist seine Ungenauigkeit. Phänomene, die oft dem „Unterbewusstsein“ zugeschrieben werden, lassen sich genauer unter wissenschaftlich definierten Begriffen wie den folgenden einordnen:
- Vorbewusst: Informationen, die leicht zugänglich sind, aber derzeit nicht im Bewusstsein vorhanden sind.
- Implizite Prozesse: Automatische, unbewusste kognitive Vorgänge, die das Verhalten beeinflussen, ohne dass man sich dessen explizit bewusst ist.
Obwohl der Begriff in der Öffentlichkeit Anklang findet, kann seine fortgesetzte Verwendung im wissenschaftlichen Diskurs zu konzeptioneller Verwirrung führen und eine klare Kommunikation über die verschiedenen Ebenen der mentalen Verarbeitung behindern. Forschende plädieren daher dafür, die Begriffe „unbewusst“, „nicht bewusst“ und „vorbewusst“ zu verwenden, um die terminologische Genauigkeit zu wahren und empirische Untersuchungen zu erleichtern.
INTERACT: Die 360° Software für Ihren gesamten Forschungs-Workflow
Von der Audio/Video-Inhaltskodierung und Transkription bis zur Analyse bietet INTERACT alles in einem Tool.
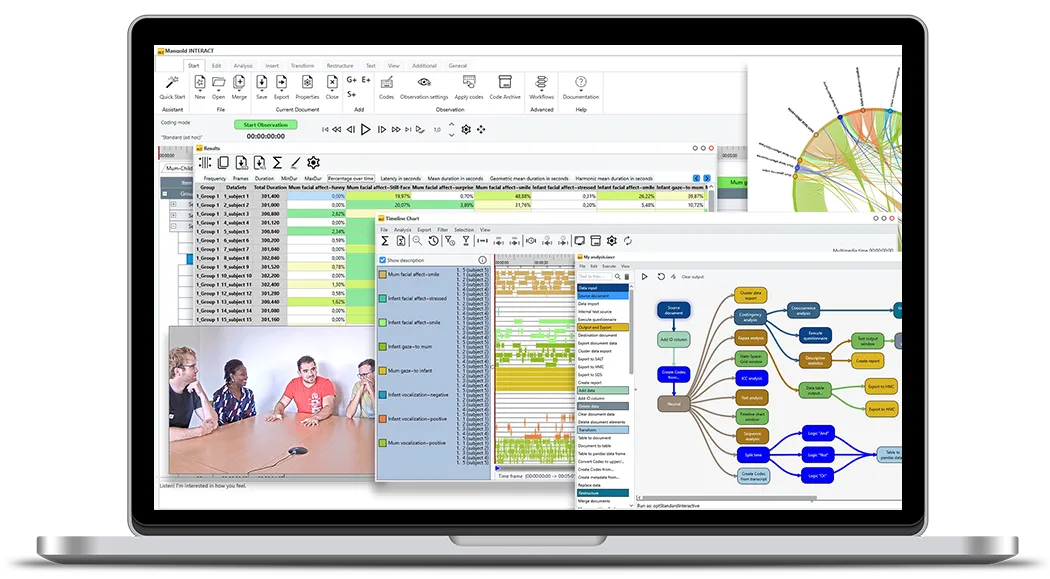
7. Methodische Ansätze zur Untersuchung nicht-bewusster und unbewusster Prozesse
Die Untersuchung mentaler Prozesse, die außerhalb des Bewusstseins ablaufen, stellt Forschende vor einzigartige methodische Herausforderungen. Um die Existenz und die Mechanismen dieser schwer fassbaren Phänomene zu erforschen, wenden Wissenschaftler eine Kombination aus neurowissenschaftlichen und verhaltenswissenschaftlichen Methoden an.
7.1. Neurobildgebende Verfahren
Die Neurobildgebung bietet wertvolle Instrumente zur Beobachtung der Gehirnaktivität, die mit unbewussten und unterbewussten Prozessen verbunden ist.
- Elektroenzephalografie (EEG): Diese misst die von Nervenzellgruppen erzeugte elektrische Aktivität und bietet eine hohe zeitliche Auflösung. Sie ist besonders nützlich, um schnelle, vorübergehende Gehirnreaktionen auf Reize zu identifizieren, die möglicherweise nicht ins Bewusstsein gelangen, wie beispielsweise ereignisbezogene Potenziale (ERPs) (Luck, 2014). ERP-Komponenten (z. B. N2pc und P300) können zwischen der bewussten und unbewussten Verarbeitung visueller oder auditiver Reize unterscheiden.
- Funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT): Sie misst Veränderungen des Blutsauerstoffgehalts (das BOLD-Signal), die auf neuronale Aktivität hinweisen. Dies bietet eine hohe räumliche Auflösung und ermöglicht die spezifischen Gehirnregionen zu identifizieren, die an unbewussten Prozessen beteiligt sind. Beispielsweise kann die Amygdala als Reaktion auf unterschwellig präsentierte angsteinflößende Gesichter aktiviert werden, selbst wenn die Testperson angibt, das Gesicht nicht bewusst wahrgenommen zu haben (Whalen et al., 1998). Sie kann auch die neuronalen Bahnen beschreiben, die an der Blindsicht beteiligt sind, und zeigt Aktivität in subkortikalen visuellen Bereichen trotz einer Schädigung von V1 (Weiskrantz, 1986).
7.2. Verhaltensparadigmen
Verhaltensexperimente dienen dazu, unbewusste Verarbeitungsprozesse zu erschließen, indem sie deren Einfluss auf beobachtbare Reaktionen aufzeigen.
- Masked-Prime-Aufgaben: Bei diesen Aufgaben wird ein Priming-Reiz sehr kurz (z. B. 10–50 ms) präsentiert und unmittelbar darauf folgt ein Maskierungsreiz, der den Priming-Reiz für das Bewusstsein unsichtbar macht. Der Nachweis für unbewusste Verarbeitungsprozesse wird durch die Wirkung des maskierten Priming-Reizes auf die Verarbeitung eines nachfolgenden Zielreizes erbracht (z. B. schnellere Reaktionszeiten bei kongruenten Priming-Reizen) (Dehaene et al., 1998).
- Reaktionszeit-Experimente: Unterschiede in den Reaktionszeiten auf verschiedene Reize können den Einfluss unbewusster Prozesse aufzeigen. Beispielsweise kann bei Aufgaben, die motorische Vorbereitungen erfordern, vor dem bewussten Erkennen der Bewegungsabsicht eine vorbereitende neuronale Aktivität (z. B. Bereitschaftspotenzial) beobachtet werden, die die Reaktionsgeschwindigkeit beeinflusst (Libet et al., 1983).
7.3. Klinische und psychometrische Ansätze
Obwohl sie weniger direkt und oft umstrittener sind, wurden bestimmte klinische und psychometrische Methoden eingesetzt, um unbewusste Inhalte zu erforschen.
- Freie Assoziation und Traumdeutung: Diese Methoden, die in der psychoanalytischen Tradition verwurzelt sind, zielen darauf ab, unbewusste Gedanken und Konflikte durch die Analyse spontaner Äußerungen und Traum Inhalte aufzudecken. Obwohl ihre wissenschaftliche Validität als empirische Instrumente für den direkten Zugang zum Unbewussten umstritten ist, spielen sie nach wie vor eine zentrale Rolle in psychodynamischen Therapien (Freud, 1915).
- Hypnose-Paradigmen: Hypnose wurde als Mittel zum Zugriff auf verdrängte Erinnerungen oder zur Beeinflussung des Verhaltens außerhalb des bewussten Willens untersucht. Forschungsergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass unter Hypnose wiedergewonnene Erinnerungen in hohem Maße anfällig für Suggestionen und Konfabulationen sind, was Bedenken hinsichtlich ihrer Genauigkeit aufkommen lässt (Loftus & Ketcham, 1994).
- Selbstauskunftsverfahren: Obwohl sie in erster Linie bewusste Erfahrungen bewerten, können Selbstauskunftsverfahren manchmal indirekte Einblicke in die Auswirkungen unbewusster Prozesse liefern (z. B. Veränderungen der Stimmung oder Präferenzen ohne klaren bewussten Grund). Per Definition ist ihre Eignung für die direkte Untersuchung unbewusster Inhalte jedoch von Natur aus begrenzt.
Diese vielfältigen Methoden, die Neurophysiologie, experimentelle Psychologie und klinische Praxis umfassen, tragen gemeinsam zu unserem sich weiterentwickelnden Verständnis der komplexen Wechselwirkungen zwischen bewussten und unbewussten mentalen Prozessen bei.
8. Theoretische Rahmenkonzepte zum Verständnis des Bewusstseins
Mehrere übergreifende theoretische Rahmenkonzepte versuchen, die Mechanismen zu erklären, die der bewussten und unbewussten Verarbeitung zugrunde liegen, über spezifische Phänomene hinaus.
8.1. Globale Arbeitsraumtheorie (GWT Global workspace theory)
Die 1988 von Bernard Baars vorgeschlagene Globale Arbeitsraumtheorie (GWT) ist ein bekanntes kognitives Modell zur Erklärung des Bewusstseins. Die GWT postuliert einen „globalen Arbeitsraum” (analog zu einer Theaterbühne), in dem Informationen aus verschiedenen spezialisierten unbewussten Prozessoren (dem „Publikum” oder den „Backstage-Mitarbeitern”) an das gesamte System weitergeleitet werden können. Sobald Informationen Zugang zum globalen Arbeitsbereich erhalten, stehen sie dem Bewusstsein zur Verfügung und können von anderen spezialisierten Modulen abgerufen werden, was eine umfassende Integration und ein flexibles, adaptives Verhalten ermöglicht. Informationen, die keinen Zugang zum globalen Arbeitsbereich erhalten, bleiben unbewusst oder nicht bewusst. Die GWT liefert ein überzeugendes Modell dafür, wie bewusste Erfahrungen aus einem riesigen Netzwerk unbewusster Berechnungen entstehen, und betont dabei die Bedeutung des globalen Informationsaustauschs innerhalb des Gehirns (Baars, 2005).
8.2. Predictive Coding und das Bayes’sche Gehirn
Predictive Coding ist eine einflussreiche Theorie in den Neurowissenschaften und Kognitionswissenschaften, die davon ausgeht, dass das Gehirn eine hierarchische Inferenzmaschine ist, die ständig Vorhersagen über sensorische Eingaben generiert und aktualisiert (Friston, 2005). Gemäß diesem Rahmenmodell sagt das Gehirn aktiv voraus, was es zu wahrnehmen erwartet, und vergleicht diese Vorhersagen mit den tatsächlichen sensorischen Informationen. Jede Diskrepanz zwischen der Vorhersage und dem Input erzeugt einen „Vorhersagefehler”, der dann in der Hierarchie nach oben weitergeleitet wird, um das interne Modell zu aktualisieren. Ein Großteil dieser prädiktiven Verarbeitung erfolgt unbewusst, wobei die bewusste Wahrnehmung aus der Minimierung von Vorhersagefehlern und der Verfeinerung des internen Modells entsteht (Clark, 2013). Die prädiktive Kodierung bietet einen einheitlichen Rahmen, durch den verschiedene kognitive Phänomene, darunter Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Lernen, verstanden werden können, und zeigt, wie unbewusste Erwartungen unsere bewusste Erfahrung und unser Verhalten tiefgreifend prägen können.
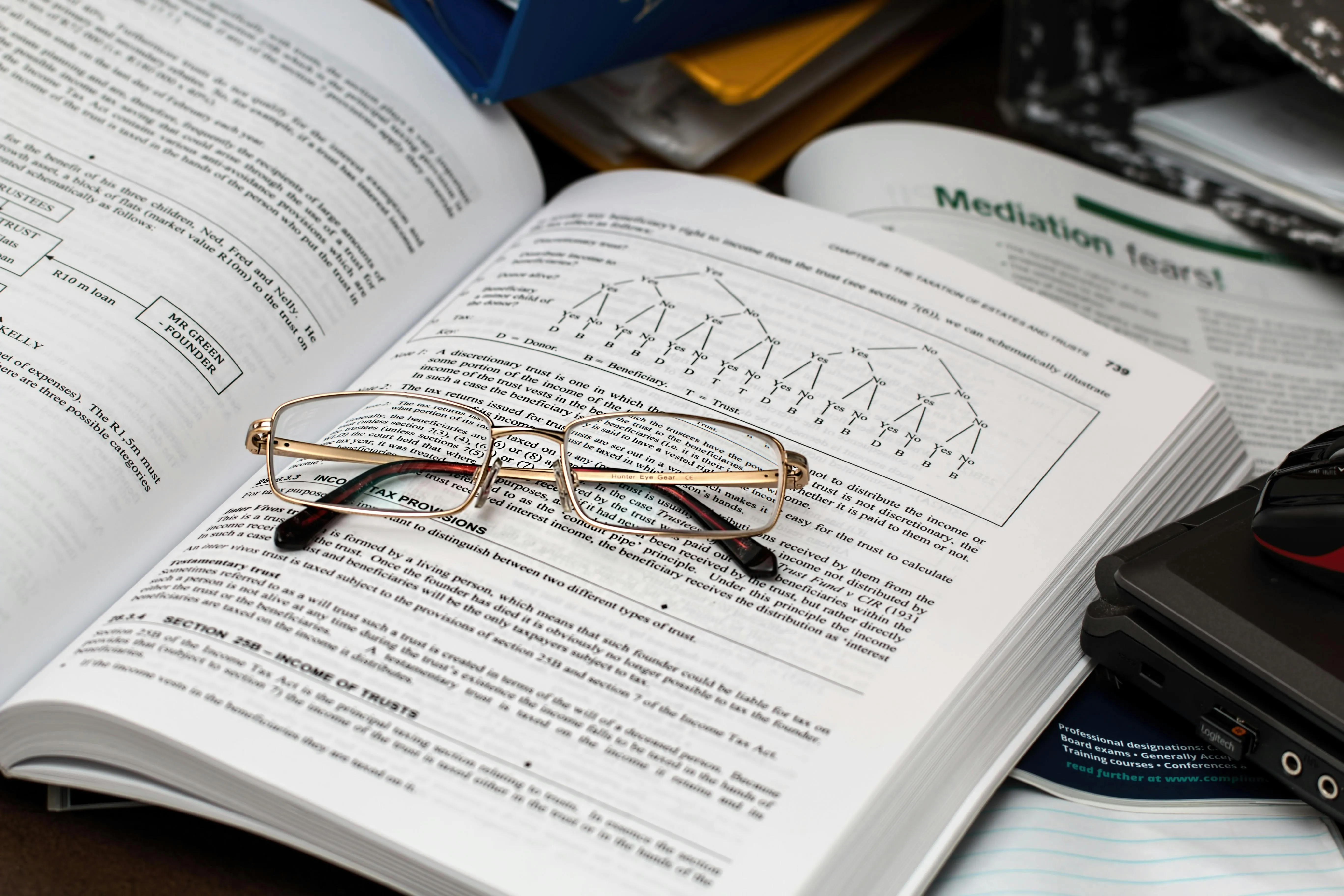
9. Auswirkungen auf die emotionale Verarbeitung und Entscheidungsfindung
Das komplexe Zusammenspiel zwischen bewussten, unbewussten und nicht-bewussten Prozessen hat tiefgreifende Auswirkungen auf unser Verständnis davon, wie Menschen Emotionen verarbeiten und Entscheidungen treffen. Diese verborgenen Ebenen des Geistes sind aktive Determinanten unserer emotionalen Zustände und Verhaltensweisen und keine passiven Speicherorte.
9.1. Emotionale Verarbeitung
Emotionale Reaktionen werden oft durch unbewusste Prozesse ausgelöst und beeinflusst. Beispielsweise zeigen Forschungsergebnisse, dass die unterschwellige Präsentation emotional auffälliger Reize (z. B. ängstliche Gesichter) die Amygdala aktivieren und physiologische Erregung (z. B. Hautleitfähigkeitsreaktionen) hervorrufen kann, selbst wenn die Personen angeben, sich der Reize nicht bewusst zu sein (Whalen et al., 1998). Dies deutet darauf hin, dass schnelle subkortikale Bahnen emotionale Informationen vorbewusst verarbeiten können, was zu affektiven Reaktionen führt, die entweder der bewussten Bewertung vorausgehen oder diese umgehen. Darüber hinaus kann implizites emotionales Lernen, wie beispielsweise die klassische Konditionierung von Angstreaktionen, ohne Erinnerung an das Lernereignis stattfinden und nachfolgende emotionale Reaktionen beeinflussen, was zu Erkrankungen wie Angststörungen beitragen kann (LeDoux, 1996). Daher ist das Verständnis dieser unbewussten emotionalen Triebkräfte entscheidend für die Entwicklung wirksamer therapeutischer Interventionen.
9.2. Entscheidungsfindung
Obwohl bewusste Überlegungen gemeinhin als Hauptantrieb für die Entscheidungsfindung angesehen werden, deuten zahlreiche Belege darauf hin, dass auch unbewusste Prozesse einen erheblichen Einfluss haben. Wie bereits erwähnt, können Priming-Effekte Urteile und Entscheidungen subtil beeinflussen, ohne dass sich der Entscheidungsträger dessen bewusst ist (Bargh & Chartrand, 1999). Heuristiken und Verzerrungen sind oft automatische, unbewusste kognitive Abkürzungen, die zu systematischen Abweichungen von rationalen Entscheidungen führen können (Kahneman, 2011).
Darüber hinaus erzeugen die prädiktiven Kodierungsmechanismen des Gehirns kontinuierliche Erwartungen, die unser Handeln und unsere Entscheidungen leiten und oft außerhalb unseres Bewusstseins ablaufen. Dies ermöglicht eine effiziente und schnelle Entscheidungsfindung in vertrauten Kontexten, während bewusste Ressourcen für neue oder komplexe Situationen geschont werden. Die unbewusste Regulierung physiologischer Zustände über das autonome Nervensystem wirkt sich auf die kognitiven Funktionen und emotionalen Zustände aus und beeinflusst damit indirekt die Entscheidungsergebnisse. So kann beispielsweise die mit Stress verbundene physiologische Erregung die exekutiven Funktionen beeinträchtigen und die Risikoeinschätzung verändern (Arnsten, 2009). Selbst die motorische Vorbereitung, ein unbewusster Prozess, spiegelt die Handlungsbereitschaft des Gehirns wider und ist eng mit unseren Absichten und Entscheidungen verbunden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass menschliche Entscheidungsfindung ein komplexes Zusammenspiel aus bewusster Argumentation und starken, oft verborgenen, unbewussten und unbewussten Einflüssen ist. Das Erkennen dieser vielschichtigen Struktur ist entscheidend für ein umfassendes Verständnis des menschlichen Verhaltens.
10. Schlussfolgerung: Auf dem Weg zu einem ganzheitlichen Verständnis des Geistes
Der menschliche Geist ist ein komplexes, vielschichtiges System, wobei bewusste Erfahrungen nur einen kleinen Teil seiner Gesamtaktivität ausmachen. Die Unterscheidung zwischen Unbewusstem, Nicht-Bewusstem und Vorbewusstem ist nicht nur eine Frage der Semantik, sondern ein wichtiger Schritt hin zu einem präziseren, empirisch fundierten Verständnis mentaler Prozesse. Obwohl der Begriff „Unterbewusstsein” im Alltagssprachgebrauch nach wie vor verwendet wird, hat er nur begrenzten wissenschaftlichen Wert, weshalb spezifischere Begriffe bevorzugt werden.
Von den historischen Erkenntnissen der Freudschen Psychoanalyse bis hin zu den modernsten Methoden der modernen Neurowissenschaften und kognitiven Psychologie entwickelt sich unser Verständnis dieser verborgenen mentalen Bereiche ständig weiter. Neuroimaging-Techniken wie EEG, ERP und fMRT sowie ausgefeilte Verhaltensparadigmen wie Masked-Prime-Aufgaben und Reaktionszeit-Experimente bieten wertvolle Werkzeuge für die Untersuchung von Prozessen, die der direkten Introspektion nicht zugänglich sind. Theoretische Rahmenkonzepte wie die Global Workspace Theory und Predictive Coding bieten überzeugende Modelle dafür, wie bewusste Erfahrungen aus einem riesigen Substrat unbewusster Prozesse hervorgehen und mit diesem interagieren.
Letztendlich ist das Erkennen des tiefgreifenden und allgegenwärtigen Einflusses dieser unsichtbaren mentalen Kräfte auf unsere Wahrnehmung, Emotionsregulation, Entscheidungsfindung und unser gesamtes Verhalten von grundlegender Bedeutung für ein ganzheitliches Verständnis des menschlichen Geistes. Die laufende interdisziplinäre Forschung zur Architektur des Bewusstseins verspricht, mehr über die außergewöhnliche Komplexität und Anpassungsfähigkeit der menschlichen Kognition zu enthüllen.
Mangold Observation Studio
Die fortschrittliche Software-Suite für anspruchsvolle sensorgestützte Beobachtungsstudien mit umfassenden Datenerfassungs- und Analysefunktionen.

Referenzen
Arnsten, A. F. T. (2009). Stress signalling pathways that impair prefrontal cortex structure and function. Nature Reviews Neuroscience, 10(6), 410-422. https://doi.org/10.1038/nrn2648
Baars, B. J. (1988). A cognitive theory of consciousness. Cambridge University Press.
Baars, B. J. (2002). The conscious access hypothesis: Origins and recent evidence. Trends in Cognitive Sciences, 6(1), 47-52. https://doi.org/10.1016/S1364-6613(00)01819-2
Baars, B. J. (2005). Global workspace theory of consciousness: toward a cognitive neuroscience of human experience. Progress in Brain Research, 150, 45-53. https://doi.org/10.1016/S0079-6123(05)50004-9
Bargh, J. A., & Chartrand, T. L. (1999). The unbearable automaticity of being. American Psychologist, 54(7), 462-479. https://doi.org/10.1037/0003-066X.54.7.462
Clark, A. (2013). Whatever next? Predictive brains, situated agents, and the future of cognitive science. Behavioral and Brain Sciences, 36(3), 181-204. https://doi.org/10.1017/S0140525X12000477
Dehaene, S., & Changeux, J. P. (2011). Experimental and theoretical approaches to conscious processing. Neuron, 70(2), 200-227. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2011.03.018
Dehaene, S., Naccache, L., Le Clec’H, G., Koechlin, E., Mueller, M., Dehaene-Lambertz, G., van de Moortele, P. F., & Le Bihan, D. (1998). Imaging unconscious semantic priming. Nature, 395(6702), 597-600. https://doi.org/10.1038/26967
Freud, S. (1915). The unconscious. In J. Strachey (Ed.), The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIV (1914-1916): On the History of the Psycho-Analytic Movement, Papers on Metapsychology, and Other Works (pp. 159-215). Hogarth Press.
Friston, K. (2005). A theory of cortical responses. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 360(1456), 815-836. https://doi.org/10.1098/rstb.2005.1622
Harrison, N. A., Kreibig, S. D., & Critchley, H. D. (2013). A two-way road: Efferent and afferent pathways of autonomic activity in emotion. In J. T. Cacioppo, L. G. Tassinary, & G. G. Berntson (Eds.), Handbook of psychophysiology (4th ed., pp. 82-102). Cambridge University Press.
Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. Farrar, Straus and Giroux.
Kouider, S., & Dehaene, S. (2007). Levels of processing during non-conscious perception: A critical review of visual masking. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 362(1481), 857-870. https://doi.org/10.1098/rstb.2007.2093
LeDoux, J. E. (1996). The emotional brain: The mysterious underpinnings of emotional life. Simon and Schuster.
Libet, B., Gleason, C. A., Wright, E. W., & Pearl, D. K. (1983). Time of conscious intention to act in relation to onset of cerebral activity (readiness-potential): The unconscious initiation of a freely voluntary act. Brain, 106(3), 623-642. https://doi.org/10.1093/brain/106.3.623
Loftus, E. F., & Ketcham, K. (1994). The myth of repressed memory: False memories and allegations of sexual abuse. St. Martin’s Press.
Luck, S. J. (2014). An introduction to the event-related potential technique (2nd ed.). MIT Press.
Reber, A. S. (1989). Implicit learning and tacit knowledge. Journal of Experimental Psychology: General, 118(3), 219-235. https://doi.org/10.1037/0096-3445.118.3.219
Schacter, D. L. (1987). Implicit memory: History and current status. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 13(3), 501-518. https://doi.org/10.1037/0278-7393.13.3.501
Vallar, G., & Perani, D. (1986). The anatomy of spatial neglect. In M. Jeannerod (Ed.), Neurophysiological and neuropsychological aspects of spatial neglect (pp. 205-221). North-Holland.
Weiskrantz, L. (1986). Blindsight: A case study and implications. Oxford University Press.
Whalen, P. J., Rauch, S. L., Etcoff, N. L., McInerney, S. C., Lee, M. B., & Jenike, M. A. (1998). Masked presentations of emotional facial expressions modulate amygdala activity without explicit knowledge. Journal of Neuroscience, 18(1), 411-418. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.18-01-00411.1998